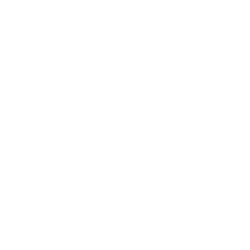Transplantationsmedizin zwischen Fortschritt und Organknappheit
Bereits im 19. Jahrhundert haben Ärzte insbesondere die Übertragung von Gewebe, vor allem der Haut, systematisch erforscht. Die erste Transplantation einer menschlichen Niere eines Toten führte der ukrainische Chirurg Voronoy schon 1936 durch, jedoch überlebte die Patientin nur wenige Tage und das Spenderorgan funktionierte zu keinem Zeitpunkt.[1] Nach dem zweiten Weltkrieg knüpfte die Forschung an diese Vorarbeiten an und legte über Immuntoleranz und Gewebeübereinstimmung die Grundlagen für die erste erfolgreiche Nierentransplantation am Menschen unter eineiigen Zwillingspärchen, die Ärzte 1954 am Bent Brigham Hospital in Boston durchführten. In Deutschland konnte Wilhelm Brosig im Jahr 1963 erstmals eine Lebendspende des gleichen Organs von einer Mutter zu ihrer Tochter realisieren.[2] Diese Erkenntnisse aus dem Bereich der Nierentransplantation ebneten in darauf folgenden Jahren den Weg für die Transplantation weiterer Organe wie z. B. Herz, Lunge, Leber oder Pankreas.[3]
Nicht beherrschbare Abstoßungsreaktionen blieben aber weiterhin das Grundproblem der Transplantationsmedizin, da adäquate Methoden zur Unterdrückung der Immunantwort des menschlichen Körpers nach wie vor fehlten. Die nicht zufriedenstellenden klinischen Ergebnisse führten dazu, dass die Transplantationsmedizin Anfang der 1970er Jahre stagnierte.[4] Durch die Entdeckung des Wirkstoffs „Cyclosporin A“ und dessen klinischer Einführung gelang 1981 ein Durchbruch: Die Rate der Abstoßungen konnte erheblich reduziert und das Transplantatüberleben deutlich verbessert werden.[5]
Seitdem hat sich die Transplantation von Spenderorganen deutlich weiterentwickelt und gilt heute als sogenannter „Goldstandard“ beim Versagen verschiedener Organe im Endstadium, da sie das Weiterleben der Patienten auch unter schwierigsten Rahmenbedingungen ermöglichen kann. So sind alleine in Deutschland von 1963 bis 2013 über 100.000 Organe transplantiert worden.[6] Doch mit der Transplantationsmedizin sind auch enorme Herausforderungen verbunden: Denn seitdem das Verpflanzen menschlicher Organe als reguläre Versorgungsaufgabe definiert ist, besteht ein absoluter Mangel an Spenderorganen – und das nicht nur in Deutschland. Damit einher geht eine häufig existentiell bedrohliche Situation für die betroffenen Patienten, denen durch eine Organübertragung geholfen werden könnte. Aufgrund des Mangels starben allein in Deutschland im Jahr 2013 mehr als 1.000 Menschen, die auf der Warteliste standen und nicht rechtzeitig ein Organ erhielten.[7] [8]
Medizinische und ethische Aspekte der Organspende
Bevor es zu einer Organentnahme kommen kann, sind komplexe Bedingungen zu erfüllen – und zwar sowohl vom potenziellen Spender als auch von den behandelnden Ärzten. Die Feststellung des eindeutigen Todes eines möglichen Spenders ist eine der zentralen Voraussetzungen für die Transplantationsmedizin. Grundlage hierfür bilden die Regeln zur Feststellung des Hirntodes. Der Hirntod ist der vollständige irreversible Ausfall aller Hirnfunktionen. Allerdings lässt sich die Bestimmung des Todes nicht auf technisch-medizinische Erkenntnisse reduzieren. Es spielen immer kulturelle, religiöse und soziale Faktoren eine Rolle, die das Verständnis des Todes oder Sterbeprozesses prägen.
Der Hirntod als Todesdefinition des Menschen geht zurück auf einschlägige Erkenntnisse, die an der Harvard Medical School in Boston, USA, erstmals 1968 publiziert wurden. Dabei handelt es sich beim Hirntod um den „Zustand der irreversibel erloschenen Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms“. So hat es auch der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer in Deutschland festgehalten: Im Rahmen der Definitionsaufgabe des Transplantationsgesetzes im Jahr 1997 haben alle medizinisch-naturwissenschaftlichen Fachgesellschaften in der Bundesrepublik festgestellt, dass „mit dem Hirntod […] naturwissenschaftlich-medizinisch der Tod des Menschen festgestellt“ werden kann.[9] Damit verbunden ist die Aussage, dass es sich beim Hirntod um ein sicheres Todeszeichen handelt und ein irreversibler Eintritt des Todes auch medizinisch festgestellt werden kann. Bei der reinen Herztod-Diagnose ist dies nicht eindeutig bzw. strittig, da ja theoretisch eine Wiederbelebung Mittels Defibrillator möglich wäre, so dass in Deutschland eine Organentnahme von Menschen, deren Herztod festgestellt worden ist, nicht erlaubt ist. Sogenannte „non heart-beating donors“ sind aber nach den gesetzlichen Bestimmungen in Österreich, Belgien und den Niederlanden möglich. Allerdings dürfen Organe, die in diesen Ländern nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand entnommen werden und die die europäische Organverteilungszentrale in Leiden auch nach Deutschland vermitteln könnte, hier nicht transplantiert werden.[10]
Dem entsprechend können nur Organe von Patienten transplantiert werden, bei denen Ärzte den Hirntod aufgrund mehrerer Kriterien festgestellt haben. Der Hirntod ist also eine zwingende Voraussetzung für die Organspende – würde diese in Frage gestellt oder gar nicht mehr als Kriterium für die „Dead Donor Rule“ gelten, könnten Ärzte aufgrund ihres Selbstverständnisses keine Organe mehr entnehmen. Schließlich dürfen sie das Leben ihrer Schutzbefohlenen nicht aktiv beenden. Die Organspende käme also zum Erliegen, und das ist unbedingt zu verhindern. Denn bereits heute übertrifft der Bedarf an postmortalen Organspenden die realisierten Spenden bei weitem. Viele Patienten mit terminalem Organversagen verlassen sich daher nicht länger nur auf die Warteliste: sie wenden sich im Ringen um eine Organspende auch an den Ehemann/die Ehefrau, andere Angehörige oder Freunde. Denn die Lebendspende ist eine medizinisch akzeptable Alternative, da Fortschritte in der Immunsuppression die Notwendigkeit einer absoluten genetischen Übereinstimmung zwischen Spender und Empfänger zum Zwecke einer erfolgreichen Transplantation beseitigt haben. Ungeachtet dessen ist ein Lebendspender eine gesunde Person und somit unter ethischen Gesichtspunkten nicht unkritisch, da eine so schwere Operation diesen Menschen gefährdet. Um dieser Problematik, die mit dem Nichtschadensprinzip zusammenhängt, adäquat zu begegnen, ist die Freiwilligkeit der Entscheidung in allen Belangen – insbesondere auch im Hinblick auf mögliche Abhängigkeiten zum Transplantationspatienten – Grundvoraussetzung für einen solchen Eingriff. Daneben gilt nach wie vor die Nachrangigkeit einer Lebendspende vor einer postmortalen Organspende. Die Tatsache, dass zu wenige Organe vorhanden sind, lässt diesen Aspekt allerdings oftmals in den Hintergrund treten. Auch für die freiwillige Entscheidung zur Organspende gilt die „Goldene Regel“, in der Jesus das Gebot für die Nächstenliebe zusammenfasst: „Alles, was ihr von den anderen erwartet, das tut auch ihnen“ (Mt. 7,12). Dies richtet unseren Blick auf das, was wir von den anderen erwarten würden, wenn wir ihrer Hilfe bedürften. Diese ethische Grundregel bewährt sich in allen Entscheidungskonflikten: Gerade weil wechselseitige Hilfe, Uneigennützigkeit und Großzügigkeit moralisch von höherem Wert als reine Tauschbeziehungen sind, kann uns diese Idee dazu anleiten, den persönlichen Einsatz auf die konkrete Not des Nächsten auszurichten. Die Entscheidung zur Organspende bewegt sich somit immer in einem Spannungsfeld zwischen der Freiheit des Einzelnen und der Verantwortung der Gesellschaft.
Spendenbereitschaft in Deutschland
Das Organspende- und Transplantationswesen hat seit 2012 durch die bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten bei der Allokation in einigen, wenigen deutschen Zentren deutlich an Vertrauen in der Bevölkerung verloren.[11] Erschwerend kommt eine seit Februar 2014 anhaltende Diskussion über Probleme bei der Hirntoddiagnostik hinzu.
Infolge dessen ist die Spendenbereitschaft in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 2002 gesunken. Hochrechnungen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) zu Folge haben im vergangenen Jahr 865 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet – 1,3 Prozent weniger als 2013. Die Zahl der gespendeten Organe stieg dabei leicht von 3.035 (2013) auf 3.049. Damit ist in den letzten beiden Jahren die Zahl der Organspender um 17 Prozent abgesunken. Dies entspricht, wie im vergangenen Jahr, einem Durchschnitt von rund 11 Spendern pro eine Million Einwohner, in 2012 waren es noch 12,8 Spender pro eine Million Einwohner. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 3.488 postmortale Spen- derorgane aus dem Eurotransplant-Verbund in Deutschland transplantiert, im Jahr 2013 waren es noch 3586.[12] Und eine Trendwende ist momentan noch nicht in Sicht.[13]
Derzeit warten rund 10.600 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan, drei von ihnen sterben im Schnitt täglich. Die nachlassende Spendenbereitschaft verschärft das eigentliche Grundproblem, den Organmangel, weiter. Um das Vertrauen zurückzugewinnen, sind eindeutige Konsequenzen entscheidend. Im Zuge der Novelle des Transplantationsgesetzes (TPG) 2012 und 2013 wurden insbesondere bei der Vergabe von Organen die Kontrollinstrumente und die Transparenz des Systems gestärkt.
Umstrukturierungen im Transplantationswesen in Deutschland
Durch die Novelle des TPG haben die Verantwortlichen einen intensiven Prozess zur Umstrukturierung und Neuregelung im Transplantationssystem initiiert, um das Vertrauen wieder zu stärken.[14]
Hierbei sind zu erwähnen:
- Das Einrichten einer Meldestelle für Auffälligkeiten: die „Vertrauensstelle Transplantationsmedizin“ der sogenannten TPG-Auftraggeber (GKV-Spitzenverband, Bundesärztekammer und Deutsche Krankenhausgesellschaft) zur (auch anonymen) Meldung von Auffälligkeiten und Verstößen gegen das Transplantationsrecht.
- Die Kontrolle der deutschen Transplantationszentren durch eine sogenannte Prüfungs- und eine Überwachungskommission, im TPG durch die Paragrafen 11 und 12 geregelt. Diese Kontrollinstanzen haben das Recht, alle Transplantationszentren in Deutschland zu prüfen. Die Kommissionen werden durch unabhängige medizinische Experten unterstützt.
- Das Einrichten von interdisziplinären und organspezifischen Transplantationskonferenzen an den Transplantationszentren. Sie entscheiden nach dem Sechs-Augen- Prinzip
o über die Aufnahme von Patientinnen und Patienten auf die Warteliste,
o über die Pflege der Warteliste,
o über die Abmeldung einer Patientin bzw. eines Patienten von der Warteliste. - Ferner werden die Richtlinien für die Wartelistenführung und die Organvermittlung aktuell überarbeitet.
- Verbessern der Transparenz für die Öffentlichkeit: Die Tätigkeitsberichte der Prüfungs- und der Überwachungskommissionen werden nunmehr unter Beachtung des Schutzes personenbezogener Daten und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies wird jährlich im Rahmen einer Pressekonferenz geschehen.
- Bestellen von Transplantationsbeauftragten: Seit 1. August 2012 sind nach § 9b Transplantationsgesetz alle Entnahmekrankenhäuser verpflichtet, Transplantations- beauftragte zu bestellen. Diese sind insbesondere dafür verantwortlich, dass potentielle Organspender identifiziert und gemeldet und die Angehörigen von Spendern in angemessener Weise begleitet werden. Sie sorgen auch dafür, dass das ärztliche und pflegerische Personal im Entnahmekrankenhaus über die Bedeutung und den Prozess der Organspende regelmäßig informiert wird und die Zuständigkeiten und Handlungsabläufe in den Entnahmekrankenhäusern zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen festgelegt werden. Der Transplantationsbeauftragte ist in Erfüllung seiner Aufgaben unmittelbar der ärztlichen Leitung des Krankenhauses unterstellt. Er ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und unterliegt keinen Weisungen. Die Transplantationsbeauftragten sind nur im Bereich der Spende tätig. Mit der Vermittlung der Organe sind sie hingegen nicht befasst.
- Unrichtige Erhebungen und Dokumentationen sowie die Übermittlung eines unrichtigen Gesundheitszustands in der Absicht, Patienten auf der Warteliste zu bevorzugen, auch als Urkundendelikt bekannt, sind strafbar.
Fazit und Ausblick
Die begonnenen Umstrukturierungen des Transplantationswesens, die die verantwortlichen Stellen durch die Gesetzesnovellen initiiert haben, sind als Prozess zu sehen, der wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Denn es gilt, einige Herausforderungen zu lösen. Dazu gehört auch, dass seit der Berichterstattung über Dokumentationsmängel in der Hirntoddiagnostik im Februar 2014 ein neues Element in die Diskussion der Organspende bzw. der Transplantationsmedizin Einzug gehalten hat: das der Qualität und des Zugangs zur Hirntoddiagnostik in Deutschland. Hier gilt es, neben der Allokation und der Verteilung der Organe auch den Prozess der Hirntoddiagnostik strukturierter und in erster Linie für die Bevölkerung transparenter zu machen. Denn: Verfügbare neurologische bzw. neurochirurgische Expertise und Zugang zu apparativen Zusatzverfahren stellen sich als wesentliche Faktoren dar, die Einleitung und Ablauf der Hirntoddiagnostik positiv beeinflussen. Konsiliardienste sind beispielsweise geeignet, Organisation und Ablauf der Hirntoddiagnostik zu verbessern.[15] Ein solch unabhängiges Konsil ist medizinisch sinnvoll und sollte in den gesamten Prozess verankert sein. Eine Berücksichtigung kann in der anstehenden Revision, die für dieses Jahr von der Bundesärztekammer angestrebt wird, Beachtung finden.
Eine weitere Herausforderung ist die von der allgemeinen und der Fachöffentlichkeit intensiv geführten Debatte über Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit[16]: Ist es medizinisch und ethisch richtig, bestimmte Patientengruppen wie Alkoholkranke vom Zugang zur Warteliste für die Leber unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen? Wie lässt sich die voraussichtliche Therapieadhärenz bei potenziellen Transplantatempfängern abschätzen, die ebenfalls für die Aufnahme auf die Warteliste bedeutsam ist? Bislang ist noch keine von mehreren, seit 2013 erarbeiteten und unter dem Genehmigungsvorbehalt des Bundesministeriums für Gesundheit stehenden Richtlinienänderungen in Kraft getreten. Ein Konsens der Gremien inklusive der Ständigen Kommission besteht bei der alkoholischen Leberzirrhose: Die Zeit der absoluten Alkoholkarenz soll wie bisher bei sechs Monaten bleiben, auch, um eine Erholung der Leberfunktion zu ermöglichen und damit möglicherweise eine Transplantation überflüssig zu machen.
Des Weiteren ist die Erfassung transplantationsmedizinischer Daten, von der Organentnahme bis hin zur Nachbetreuung in einem nationalen Transplantationsregister ein wichtiger und dringend notwendiger Schritt für eine weitere Verbesserung der Versorgungsqualität in der Transplantationsmedizin. Das Register kann eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung der Wartelistenkriterien bilden und soll zu einer größtmöglichen Transparenz bei der Vergabe von Spenderorganen führen – beides Voraussetzungen, um die Zustimmung der deutschen Bevölkerung zur Organspende wieder zu erhöhen. Dazu gehört auch, ökonomische Anreize im Management des Transplantationswesens abzuschaffen, um möglicher Manipulation vorzubeugen. Daher gilt es, das gesamte System von einer fall- abhängigen Vergütung zu entkoppeln. Nur eine konsequente Bearbeitung dieses Aspektes sowie die Umsetzung in der Gesetzesnovelle ist in der Lage, die Basis für ein transparentes System und damit für Vertrauen der Bevölkerung in die Organspende zu schaffen. Und das wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass die Zahl der Organspendeausweisträger und damit der gespendeten Organe langfristig wieder steigt – und wir mehr Menschen helfen können, als das heute der Fall ist. Schließlich warten Nierenkranke in Deutschland im Durchschnitt mehr als sechs Jahre auf ein Spenderorgan, in Spanien hingegen nur zwischen ein bis zwei Jahre – hier muss dringend eine Verbesserung für deutsche Patienten erreicht werden. Nicht zuletzt ist die Information und Aufklärung der Bevölkerung entscheidend. Die Repräsentativumfrage im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) von 2013 zeigt eine Rate an Organspenderausweisträgern von 28 Prozent.[17] Diese Befragung ergab aber auch, dass immerhin 68 Prozent der Befragten grundsätzlich bereit wären, Organe oder Gewebe nach dem Tod zu spenden. Nach eigenen Angaben fühlt sich nur die Hälfte der Befragten gut oder sehr gut über das Thema „Organ- und Gewebespende“ informiert. Aber im persönlichen Bedarfsfall wünschen sich 83 Prozent eine Organtransplantation. Deshalb sind Kampagnen zur Förderung der Organspendebereitschaft sehr wichtig, da sie relevante Informationen zur Organspende transportieren und für die Problematik des Organspendermangels sensibilisieren. Dass bei besonders gut informierten Personen eine sehr hohe Rate an Organspenderausweisträgern von über 60 Prozent erreichbar ist, zeigen Umfragen bei Medizinstudenten in Essen.[18]
Fußnoten
1 Vgl. Schlich, T (1998): Die Erfindung der Organtransplantation. Frankfurt u.a.: Campus, S. 7-10.
2 Vgl. Achilles, M (2004): Lebendspende-Nierentransplantation. Berlin u. a.: LIT Verlag, S. 99.
3 Vgl. Walter, J/Burdelski, M/Bröring, DC (2008): Chancen und Risiken der Leber-Lebendspende- Transplantation. In: Deutsches Ärzteblatt, 105(6), S. A101-A107; Lehmkuhl, H/Hetzer, R (2006): Herztransplan- tation. In: Krukemeyer, M/Lison, A (Hrsg.): Transplantationsmedizin. Berlin u. a.: Gruyter, S. 123-148.
4 Vgl. Schüttler, J (2003): 50 Jahre Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Tradition und Innovation. Berlin u.a.: Springer, S. 218-219.
5 Vgl. Doxiadis, I/Smits, J/Persijn, G et al. (2004): It takes six to boogie: Allocating cadaver kidneys in Eurotrans- plant. In: Transplantation, 77(4), S. 615-617.
6 Vgl. DSO (2010): Organtransplantationen seit 1963. URL: dso.de/grafiken/g27.html [Zuletzt abgerufen am 22.03.2011].
7 Vgl. Eurotransplant (2013): Annual Report 2013. URL: https://www.eurotransplant.org/cms/mediaobject.php?file=AR20135.pdf, S. 54 – 55 [Zuletzt abgerufen am 17.01.2015].
8 Diese Zahl erhöht sich zudem, wenn auch diejenigen Patienten berücksichtigt werden, die wegen ihres schlechten Gesundheitszustands von der Warteliste genommen werden mussten. Vgl. Alber (2011): Priorisie- rung in der Medizin. Stakeholderpräferenzen bei der Allokation knapper Spenderorgane. Bayreuth: PCO, S. 13.
9 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer (1998): Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes. Dritte Fortschreibung 1997. In: Deutsches Ärzteblatt, 95, (30), S. A1861-1868.
10 Vgl. Bundesärztekammer (1998): Organentnahme nach Herzstillstand („Non heart-beating donor“). In: Deut- sches Ärzteblatt, 95(50), S. A3235.
11 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA ) (2015) https://www.organspende- info.de/infothek/studien , eingesehen 19.01.2014
12 Eurotransplant 2015, einsehbar unter https://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=newsitems&oid=458&action=viewitem&id=6990 , eingesehen 19.01.2014
13 Deutschen Stiftung Organtransplantation (2015), einsehbar unter www.dso.de/home.html , eingesehen 19.01.2014 (alle Zahlen aus dem Jahr 2014 sind vorläufige Zahlen)
14 Transplantationsgesetz; einsehbar unter www.gesetze-im-internet.de/tpg/ ; zuletzt eingesehen am 20.01.2015
15 O. Hoffmann und F. Masuhr (2014) Zugang zur Hirntoddiagnostik. Nervenarzt 2014; 85:1573–1581
16 Deutsches Ärzteblatt (2014) einsehbar unter www.aerzteblatt.de/nachrichten/61520/Zahl-der-Organspender-stabilisiert-sich
17 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 2013, einsehbar unter https://www.organspende- info.de/infothek/studien , aufgerufen am 22.01.2015
18Radunz S, Juntermanns B, Heuer M, Frühauf NR, Paul A, Kaiser GM. The effect of education on the attitude of medical students towards organ donation. Ann Transplant. 2012 Jan-Mar;17(1):140-4.